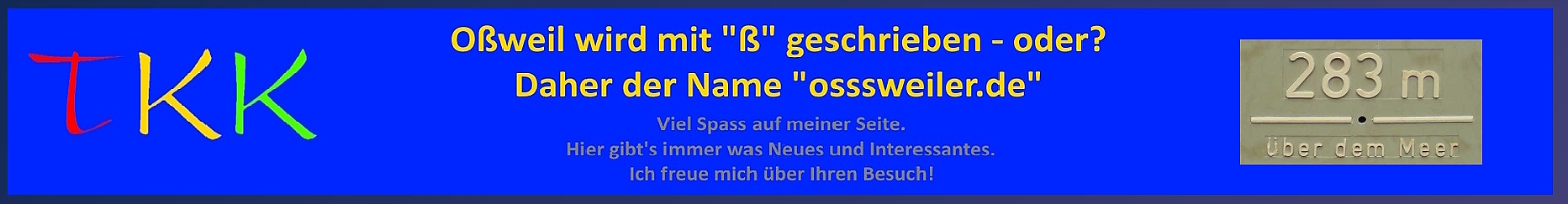Ludwigsburger Torhäuser

Der Bau der Stadtmauer wurde 1758 begonnen und im Wesentlichen 1760 abgeschlossen.
Die Stadtmauer, die Stadttore und die Torhäuser (ursprünglich Torwachthäuser) bildeten eine geschlossene Einheit.
Die Stadtmauer war nicht zur Verteidigung gegen einen Feind von außen gedacht, sondern zur Verhinderung von Desertionen der in der Stadt (meist gegen ihren Willen) kasernierten Soldaten.
Die etwa sechs Kilometer lange und etwa 3 ½ m hohe Stadtmauer hatte sieben Stadttore (eine Toranlage bestand aus einem Haupttor und Nebentoren) an den Straßen nach Stuttgart, Leonberg bzw. Pflugfelden, ins Osterholz, nach Bietigheim bzw. Asperg, Marbach, Schorndorf und Aldingen/Oßweil.
In den Torhäusern befanden sich das Wachtlokal der Torwache und die Wohnung des Torschreibers oder Torwarts, der die Torschlüsselgewalt innehatte.
Die Torwache und weitere an der Stadtmauer eingesetzte Posten wurden von den in Ludwigsburg stationierten Truppen gestellt.
Die Aufgabe der Torwache bestand neben der Unterstützung des Torwarts aus Repräsentationspflichten und der Kontrolle der Passanten.
Hausherr im Torhaus war der Torschreiber oder Torwart. Als alleiniger Hüter der Torschlüssel und Eintreiber staatlicher Zölle (z.B. für Wein oder Bier) und städtischer Abgaben (z.B. Pflastergeld) nahm er herrschaftliche und städtische Interessen wahr und wurde auf eine eigene Dienstvorschrift vereidigt.
Das Pflastergeld war ein in früheren Zeiten übliches Wegegeld, das eine Stadt für die Benutzung ihrer Straßen erheben durfte. Es musste für Personen, Fuhrwerke und Tiere gezahlt werden. 1817 wurde der Betrieb der Torhäuser privatisiert, d.h. die Torwarte arbeiteten als Subunternehmer auf eigenes Risiko. Jeweils auf ein Kalenderjahr wurden der Schließdienst im Torhaus und der Einzug des Pflastergeldes öffentlich im Rathaus an den Meistbietenden versteigert.
Das Pflastergeld wurde in Ludwigsburg erst 1912 abgeschafft.